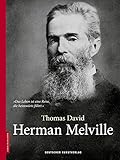Vom Abenteuerschriftsteller zum Autor der Weltliteratur
Zum 200. Geburtstag von Herman Melville
Von Manfred Orlick
Walt Whitman und Herman Melville – zwei amerikanische Weltpoeten des 19. Jahrhunderts, deren Geburtstage sich innerhalb weniger Wochen zum 200. Mal jährten. Beide gelten heute als Wegbereiter der Moderne: Whitman mit seinen Leaves of Grass als Begründer der modernen amerikanischen Lyrik, Melville als Vorläufer der modernen Prosaliteratur. Beide, sie sind sich nie begegnet, waren zudem wortgewaltige Künder der Freiheit und Demokratie, aber auch (vor allem Melville) kritische Beobachter ihrer Zeit. Während Whitman bei seinen Zeitgenossen Anerkennung fand, stieß Melville (abgesehen von seinen Südsee-Romanen) mit seinen Werken zumeist auf taube Ohren, ja auf Unverständnis und Ablehnung. Daher ist es geradezu eine Pflicht, an den Schriftsteller zu erinnern, der mit seinen literarischen Auffassungen seiner Zeit weit voraus war, und der mit seiner Kombination aus Weltoffenheit und Individualismus gerade den heutigen Leser anspricht.
Herman Melville wurde am 1. August 1819 als drittes Kind des Kaufmanns Allan Melville und seiner Frau Maria, geborene Gansevoort, in New York geboren. Der Vater war schottisch-irischer Herkunft und im Pelzhandel tätig. Doch die Geschäfte liefen nicht gut und die Familie musste öfters den Wohnort wechseln; schließlich ließ sie sich im provinziellen Albany nieder. Angesichts des Konkurses und drohenden Bankrotts starb der Vater 1832 und hinterließ eine achtköpfige Familie mittellos. Der dreizehnjährige Herman wurde von der Schule genommen, damit er etwas zum Unterhalt der Familie beitragen konnte. Zunächst wurde er als Aushilfe zu Verwandten in ein New Yorker Bankhaus geschickt, danach war er auf einer Farm tätig und anschließend wieder als Gehilfe im Pelzhandel eines Onkels. Zwischendurch besuchte er sporadisch die Schule.
Der junge Melville musste Geld verdienen; da an Land scheinbar kein ergiebiger Beruf zu finden war, versuchte er mit 19 Jahren sein Glück auf See. Er heuerte als Kabinenjunge auf einem Postschiff der Route New York–Liverpool an. Liverpool war damals eine der größten Hafenstädte der Welt. In den Docks kam er mit den europäischen Auswanderern in Kontakt, die auf ihre Überfahrt in die neue Heimat warteten. Wieder daheim – die Rückreise dauerte immerhin fast sieben Wochen – versuchte sich Melville erfolglos als Hilfslehrer, sodass er schließlich Anfang 1841 in Nantucket, dem geschäftigsten Walfanghafen der Welt, auf dem Walfänger „Acushnet“ anheuerte. Die Bedingungen an Bord waren so katastrophal, dass Melville, als das Schiff eine Inselgruppe des Marquesas-Archipels in der Südsee erreichte, die Gelegenheit nutzte und mit einem Kameraden namens Richard Tobias (Toby) Greene von Bord desertierte. Sie verschwanden im Urwald, wo sie von den Eingeborenen, die Kannibalen waren, aufgegriffen wurden. Während sein Begleiter fliehen konnte, lebte Melville mehrere Wochen bei den Typees und konnte so viel über ihr Leben in Erfahrung bringen. Schließlich gelang es ihm, mit dem australischen Walfänger „Lucy Ann“ die Insel zu verlassen. Als es jedoch zu einer Meuterei auf dem Schiff kam, wurden die Rädelsführer – unter ihnen Melville – auf Tahiti ausgesetzt und wegen Arbeitsverweigerung gefangengesetzt. Nach der Flucht aus dem Gefängnis ging seine abenteuerliche Reise weiter auf dem Walfänger „Charles and Henry“, ehe er dann an Bord der Fregatte „United States“ der amerikanischen Kriegsmarine nach einem Zwischenaufenthalt in Peru 1844 wieder nach Boston zurückkehrte.
Von seinen Abenteuern existieren keine schriftlichen Zeugnisse, keine Briefe oder Tagebuchaufzeichnungen. Trotzdem hatte Melville genügend Rohstoff in diesen knapp fünf Jahren gesammelt und er begann nach seiner Rückkehr, die Erlebnisse in einigen Romanen festzuhalten. In rascher Folge entstanden so Typee (1846, dt. Taipi), Omoo (1847, dt. Omu), Mardi (1849, dt. Mardi und eine Reise dorthin), Redburn (1949) und White-Jacket or The World in a Man-of-War (1850, dt. Weißjacke oder Welt auf einem Kriegsschiff). In seinem Erstlingswerk Typee verarbeitete Melville seinen Aufenthalt auf dem Südsee-Eiland Nukuhiwa in den Marquesas bei dem polynesischen Stamm der Typees; eindrucksvoll schilderte er die Naturschönheiten der grünen Insel und das Gemeinschaftsleben der Eingeborenen:
Unregelmäßig in diesen Tälern verstreut, unter schattigen Zweigen der Kokosnußbäume, liegen die Häuser der Eingeborenen, aus gelbem Bambus erbaut, dessen Stäbe mit einer Art von Weidengeflecht geschickt und geschmackvoll verbunden sind. Das Dach besteht aus den langen spitzen Blättern der Zwergpalme.
Der Roman Omoo nahm die Fäden der Handlung wieder auf – mit der Schilderung der Zustände und der Meuterei auf dem verwahrlosten Walfänger „Lucy Ann“ sowie mit der Verhaftung auf Tahiti. Als der Walfänger mit neuer Besatzung ablegte, kümmerte man sich jedoch nicht mehr um die Gefangenen. Melville führte wochenlang ein sorgloses Vagabundenleben, in dem er die Insel durchstreifte. Der Titel des Buches geht auf die Südsee-Sprache zurück, in der „Omoo“ „Wanderer“ oder „Landstreicher“ bedeutet. Sind Typee und Omoo nun Romane oder doch eher Reiseberichte? Über diese Frage streiten noch heute die Literaturhistoriker.
Beide Südsee-Geschichten waren große Erfolge und Melville wollte fortan sein Glück als freier Schriftsteller versuchen. 1847 hatte er Elizabeth (Lizzie) Shaw, die Tochter des Obersten Richters von Massachusetts, geheiratet: Das junge Paar wohnte zunächst in New York; um jedoch mehr Ruhe für seine literarischen Projekte zu finden, zog es Melville aufs Land. In der Nähe des Ortes Pittfields erwarb man ein Farmhaus und ein großes Grundstück. Das Anwesen nannte Melville „Arrowhead“ (dt. Pfeilspitze), weil er im Garten auf indianische Pfeilspitzen gestoßen war.
Mit seinem nächsten Roman Mardi erntete Melville bei den Kritikern und Lesern allerdings nur Kopfschütteln: der Roman überforderte sie. Melville brach die damaligen starren Erzählschemata auf, verzichtete auf autobiografische Erlebnisberichte und ließ seiner Fantasie freien Lauf. Ein fast 1.000 Seiten umfassendes und doch unterhaltsames Wunderwerk, eine wilde und überquellende Mischung aus Seemannsgarn, Südsee-Romanze, Satire, philosophisch-theologischen Betrachtungen und Gesellschaftskritik. Bereits im Vorwort warnte er den Leser:
Nachdem ich in jüngster Zeit zwei Reiseerzählungen aus dem Pazifik veröffentlicht hatte, die mancherseits ungläubig aufgenommen wurden, kam mir der Gedanke, tatsächlich ein Südseeabenteuer als Fantasieerzählung zu schreiben, um zu sehen, ob diese Fiktion nicht möglicherweise für wirklich genommen werden kann: in gewissem Grade die Umkehrung meiner vorigen Erfahrung.
Diesem Gedanken entsprossen andere, die Mardi zum Ergebnis hatten.
Wie ein Seemann macht Melville danach die erzählerischen Leinen los und sticht mit kraftvoller Sprache in ein Meer voller uferloser Geschichten. Es ist eine utopische Reise um den Globus, die der desertierte Seemann Taji mit einem Kameraden unternimmt, immer auf der abenteuerlichen Suche nach der geheimnisvollen Schönen Yillah. Heute wird Mardi als Vorläufer des Klassikers Moby-Dick angesehen.
Nach diesem Fehlschlag verfasste Melville in schneller Folge zwei Romane, die an die Südsee-Romane Typee und Omoo anknüpften und ein Zugeständnis an Verlag und Publikum waren. Seinem Verleger hatte er „keine Metaphysik“ versprochen; schließlich musste er mit seinen Büchern Geld verdienen: „Ich war dazu gezwungen, so wie andere Leute zum Holzsägen.“ Während er in Redburn seine Erlebnisse als Kabinenjunge auf dem Postschiff verarbeitete, schilderte er in White-Jacket die Vorgänge in der amerikanischen Kriegsmarine. Trotz der autobiografischen Bezüge sind die beiden Romane keine reinen Erinnerungsbücher; Melville setzte sich darin beispielsweise auch mit den Auswüchsen des Frühkapitalismus in Liverpool oder mit dem menschenverachtenden Drill auf den Kriegsschiffen auseinander. Auspeitschungen, schlechte Bezahlung, kaum Urlaub, Unfähigkeit der Offiziere – Melville nahm kein Blatt vor den Mund. „Wo es um die Wahrheit ging, gab Melville selbst kein Pardon. Niemals hat ein Schriftsteller seinen Lesern die Wirklichkeit furchtloser dargestellt als er in White-Jacket“, bescheinigte ihm sein Schriftstellerkollege Nathaniel Hawthorne (1804–1864). Im Grunde genommen war White-Jacket also ein politisches Buch; seine drastischen Darstellungen sollen auch zur Abschaffung der Prügelstrafe in der US-Marine beigetragen haben.
Im Oktober 1849 unternahm Melville eine dreimonatige Reise, die ihn nach London und auf den europäischen Kontinent (Paris und Rhein) führte, wo er wichtige Eindrücke und Erfahrungen sammelte, die in seinen späteren Romanen, Erzählungen und Gedichten ihren Niederschlag fanden. Auf der fünfwöchigen Rückreise von Portsmouth nach New York stellte er Überlegungen für ein neues Buchprojekt an. Voller Pläne und mit Tatkraft stürzte er sich in den folgenden 16 Monaten in der Abgeschiedenheit von „Arrowhead“ an sein Walfangbuch The Wale, das er erst im allerletzten Augenblick in Moby-Dick umbenannte. Zwischen den Schreibexzessen musste er sich um die Farm und die Felder kümmern. White-Jacket hatte zwar aufgrund der kritischen Auseinandersetzung mit der US-Marine einen gewissen Verkaufserfolg, aber schon bald drückten wieder die Schulden. Überhaupt sollten Redburn und White-Jacket die letzten Bücher sein, mit denen Melville ernsthaft Geld verdiente.
Mit Moby-Dick (der Titel schreibt sich wirklich mit Bindestrich) präsentierte Melville seinen Lesern keine leichte Lektüre. Es war nicht die erwartete unterhaltsame Abenteuergeschichte von Kapitän Ahab und der Jagd auf den weißen Wal. „Call me Ishmael“ („Nennt mich Ismael“) – mit diesen banalen Worten beginnt sein Meisterwerk. Erzähler ist der Matrose Ismael (sein voller Name wird nie genannt), der mit dem tätowierten Südsee-Insulaner Queequeg an Bord des Walfängers „Pequod“ geht. Erst spät (im 29. Kapitel) taucht der charismatische Kapitän Ahab auf und macht die Mannschaft mit dem eigentlichen Ziel der Fahrt vertraut: Er will Moby Dick, den riesigen weißen Wal, der ihm bei einem früheren Walfangunternehmen das Bein abrissen hatte, jagen und erlegen. Von grenzenlosem Hass getrieben, schwört er die Mannschaft auf das irrationale Vorhaben ein. Einziger Gegenpart, der dem Kapitän widerspricht, ist der erste Obermaat Starbuck, ein kühner, erfahrener und tief religiöser Seemann. Ahabs Rachefeldzug führt schließlich ins Verderben. Als Einziger überlebt Ismael die Katastrophe. Auf dem Sarg von Queequeg kann er sich über Wasser halten und wird später von einem Walfänger entdeckt.
„Das Schiff! Die Totenbahre! Die zweite Totenbahre!“ rief Ahab vom Boot aus. „Das Holz konnte nur amerikanisches sein!“ Der Wal tauchte unter das Schiff und schwamm mit zitternder Bewegung unter dem Kiel desselben entlang. Als er sich unter dem Wasser umgewandt hatte, schoß er geschwind wieder an die Meeresoberfläche in ziemlicher Entfernung von dem anderen Bug, aber immerhin noch in einiger Entfernung von einigen Yards von Ahabs Boot, wo er eine Zeitlang ruhig liegenblieb. […] „Bis zum letzten will ich mit dir ringen! Mit einem Herzen, das mit Höllengedanken erfüllt ist, steche ich nach dir! Weil ich dich hasse, speie ich dir meinen letzten Atem entgegen! Wenn auch alle Särge und alle Totenbahren in einem gemeinen Pfuhl versinken, und da diese nicht für mich bestimmt sind, so will ich denn, wenn ich dich jage, und wenn ich auch mit dir verbunden bin, dich verfluchten Wal, in Stücke reißen! Und so lasse ich denn meinen letzten Speer fallen!“
In dem mitreißenden Roman, eine Allegorie auf „die ewige Selbstüberschätzung des Menschen angesichts der Naturgewalten“, wird die Handlung immer wieder durch seemännische, mythologische oder wissenschaftliche Exkurse unterbrochen. Dazu kommen Betrachtungen über die Natur und ihre Zerstörungskraft sowie ausführliche Darstellungen des Lebens an Bord, die ebenfalls nahtlos integriert sind. Der Walfänger „Pequod“ mit seinen Protagonisten ist ein Mikrokosmos, eine Shakespeare-Bühne mit einem rücksichtslosen Willensmenschen, dem Melville die Größe eines König Lear mit faustischen Zügen verleiht. Tatsächlich hatte sich Melville während der Niederschrift intensiv mit William Shakespeare und Johann Wolfgang Goethe beschäftigt, um eine zentrale Figur für seinen Roman zu finden, den er schließlich Nathaniel Hawthorne widmete. Der Schriftstellerkollege wohnte in der Nachbarschaft und beide verband eine kurze, aber intensive Freundschaft. Inwieweit Hawthorne Einfluss auf den Roman hatte, lässt sich bis heute nicht zufriedenstellend beantworten. Aus Briefen geht nur hervor, dass er Melville in der Absicht bestärkte, die Darstellung des Walfangs im 19. Jahrhundert zu einem gewaltigen Epos auszudehnen.
Melvilles Buch über den rätselhaften weißen Wal stieß allerdings bei den Zeitgenossen auf wenig Interesse. Der anfängliche Verkaufserfolg erlahmte schnell, nach einigen Monaten waren von Moby-Dick lediglich knapp 3.000 Exemplare verkauft. Im Grunde war Melvilles Schriftstellerkarriere damit gescheitert. Noch einmal versuchte er, mit seinem nächsten Roman Pierre: or, The Ambiguities (1852, dt. Pierre oder die Doppeldeutigkeiten) für den „Literaturmarkt“ zu schreiben. Kein Buch, das auf der wilden See spielt, sondern ein Familienroman, der als romantische Liebesgeschichte beginnt und schließlich in einer Katastrophe endet. Melville konfrontierte die Leser mit Tabuthemen wie puritanische Doppelmoral, wilde Liebesgemeinschaften oder gar Inzest. Damit hatte sich Melville endgültig ins literarische Abseits geschrieben („Ein Buch direkt aus dem Irrenhaus“). Selbst Freunde und Förderer waren entgeistert. Pierre, als Erfolgsroman geplant, hinterließ nur weitere Schulden.
Melville war sich danach durchaus bewusst, dass er sich noch so ein „gescheitertes Buch“ nicht leisten konnte. „Er taumelt am Rande des Abgrunds“, ahnte es 1853 der junge irische Immigrant und Schriftsteller Fitz-James O’Brien (1828–1862). Melville ließ die Erzählung Bartleby the Scrivener (dt. Bartleby der Schreiber) folgen, die 1853 zunächst in zwei Teilen in der Zeitschrift Putnam’s Monthly Magazine erschien. Ein alternder Anwalt (der Ich-Erzähler) hat eine neue Schreibkraft namens Bartleby eingestellt, die zunächst die aufgetragenen Arbeiten mit Fleiß und Hingabe erfüllt. Aber plötzlich verweigert Bartleby die Büroarbeiten. Völlig ungerührt antwortet er stets: „I would prefer not do“ („Ich möchte lieber nicht“).
Einige Augenblicke stand ich, zur Salzsäure erstarrt, an der Spitze meiner sitzenden Angestelltenkolonne. Dann fasste ich mich wieder, trat auf den Wandschirm zu und fragte nach dem Grund solch ungewöhnlichen Verhaltens.
„Warum weigern Sie sich?“
„Ich möchte lieber nicht.“
Bei jedem anderen Menschen wäre ich auf der Stelle in einen furchtbaren Zorn geraten, hätte es verschmäht, noch ein einziges weiteres Wort zu sagen, und ihn schimpflich hinausgeworfen. Aber Bartleby hatte etwas an sich, was mich nicht nur seltsam entwaffnete, sondern auch auf eine wunderliche Art rührte und in Verwirrung brachte. Ich begann, ihm vernünftig zuzureden.
Bartleby wird immer schweigsamer und landet schließlich im Gefängnis, wo seine Arbeitsverweigerung in eine generelle Lebensverweigerung umschlägt. Nach ein paar Tagen findet ihn sein Dienstherr, der ihn besuchen will, zusammengekauert und tot im Innenhof des Gefängnisses liegen. Mit seinem Aufbegehren gegen bestehende Normen machte Bartleby aber auf Melvilles Zeitgenossen keinen Eindruck, erst im 20. Jahrhundert wurde der radikale Individualist Bartleby zu einer Schlüsselfigur der modernen Weltliteratur.
Melville musste sich eingestehen, dass er mit der Wahrheit, mit dem, was er schreiben wollte, kein Geld verdienen konnte. In den folgenden Jahren kamen zwar noch die Erzählung Benito Cereno (1855), der historische Roman Israel Potter (1855), der Sammelband mit Erzählungen The Piazza Tales (1856, dt. Piazza-Erzählungen) und der satirische Roman The Confidence Man (1857, dt. Maskeraden oder Vertrauen gegen Vertrauen) hinzu, doch es waren meist Lohnarbeiten.
„Die Not schaut ständig zur Tür herein und es gibt keine schöpferische Muße, in der ein Gedanke reifen und sich klären könne.“ Körperlich und seelisch erschöpft, unternahm Melville 1856/57 eine Reise nach Europa und ins Heilige Land, finanziert von Lemuel Shaw, dem Obersten Richter von Massachusetts, der ein treuer Freund und Helfer der Familie war. Nach seiner Rückkehr tingelte er mit Vorträgen über seine Pazifik-Erlebnisse durchs Land; daneben schrieb er Gedichte, die in dem Zyklus Battle Pieces (1866, dt. Schlachtstücke) erschienen. Hier setzte er sich mit den traumatisierenden Wirkungen des amerikanischen Bürgerkriegs auseinander. Mit seinem jüngeren Bruder Thomas, Kapitän auf dem Klipper „Meteor“, wollte Melville 1860 von New York aus die Welt umschiffen. Er versprach sich viel von dieser Seereise, brach sie jedoch in San Francisco ab. 1863 verkaufte er schließlich die Farm in Pittsfield und die Familie siedelte nach New York über.
Eigentlich könnte hier der Rückblick auf Melvilles Biografie beendet werden, zumindest was seine Schriftstellerlaufbahn betrifft. Aber noch lagen 25 Jahre vor ihm. Um seine Familie ernähren zu können, trat er im Dezember 1866 eine Stelle als Zollinspekteur der New Yorker Zollbehörde an. Damit legte er den Beruf des freischaffenden Schriftstellers endgültig nieder. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1885 war es seine tägliche Aufgabe, bei Wind und Wetter an Bord der vor Anker liegenden Schiffe zu klettern und ihre Fracht zu kontrollieren. Im September 1867 fand man seinen ältesten Sohn Malcolm tot im Bett, mit einer Schusswunde am Kopf. War es ein Unfall oder Selbstmord des 18-Jährigen? Für Melville und seine Frau Lizzie ein schwerer Schicksalsschlag. Außerdem wurde der Bekanntenkreis durch weitere Todesfälle immer kleiner.
Trotz seiner wenig erfreulichen Arbeit als Zollinspekteur, die er aber stets pflichtbewusst erfüllte, hatte Melville das Schreiben aber nie ganz eingestellt. Kunst und Literatur blieben ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. So entstand in der knappen Freizeit der gewaltige Versepos Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land (1876) über eine Pilgerreise durchs Heilige Land – eine poetische Suche nach dem Sinn des Lebens und dem Ursprung der Religion. Das Erzählgedicht mit 4 Teilen, 150 Cantos und etwa 18.000 Versen ist das gewaltigste Gedicht der amerikanischen Literatur, aber zugleich das unbekannteste. Sein letztes Werk war die Seefahrer-Geschichte Billy Budd (zwischen 1886 und 1891), die über Jahrzehnte verschollen blieb und erst 1924 wiederentdeckt wurde. Am 28. September 1891 starb Herman Melville im Alter von 72 Jahren. Auf dem Woodlawn-Cemetery, im New Yorker Stadtteil Bronx, wurde er neben seinem Sohn Malcolm bestattet. Die Öffentlichkeit nahm jedoch keinerlei Notiz von seinem Tod.
Als Melville starb, war sein Werk bereits vergessen. Selbst in den Katalogen berühmter Bibliotheken wurde sein Moby-Dick lediglich in der Kategorie „Cetologie“ (Wissenschaft von den Meeressäugern) geführt. Im 19. Jahrhundert waren nur Typee, Omoo (1847 durch Friedrich Gerstäcker) und Redburn für den deutschen Leser zugänglich. Erst in den 1920er Jahren begann man, Melville wieder zu entdecken. Die deutsche Erstübersetzung von Moby-Dick erschien 1927 in der von Thomas Mann („Oh, hätte ich das geschrieben.“) herausgegebenen Reihe Romane der Welt – allerdings als dünner Abenteuerroman. (Bis heute wird der Roman häufig zum Abenteuer- und Jugendbuch umgeschrieben.) Seine vollständige Übertragung erfolgte schließlich 1942 in Zürich. Viel zur Melville-Popularität hat die Moby-Dick-Verfilmung (1956) von Regisseur John Huston (mit Gregory Peck in der Rolle von Kapitän Ahab) beigetragen.
Erfreulicherweise hat in den letzten beiden Jahrzehnten im deutschen Sprachraum eine Melville-Renaissance eingesetzt mit zahlreichen Neuübersetzungen und Neuausgaben, was gerade auch zum diesjährigen Melville-Jubiläum spürbar wird. Der Diogenes Verlag überrascht gleich mit drei Neuerscheinungen. Allen voran der gewaltige Epos Moby-Dick in der heute schon klassischen Übersetzung aus den 1940er Jahren von Thesi Mutzenbecher und Ernst Schnabel, die erstmals 1946 im Verlag Claassen & Goverts erschien. Die Diogenes-Ausgabe wird durch den Essay Herman Melville und Moby-Dick (1954, in Ten Novels and Their Authors) von W. Somerset Maugham (1874-1965) ergänzt. Der britische Schriftsteller gibt einen kurzen Überblick über Melvilles Biografie und setzt sich dann durchaus kritisch mit dem Aufbau und den Abschweifungen des Romans auseinander: „Weil Hermann Melville Ahab schuf, ist Moby-Dick trotz aller möglichen Vorbehalte ein großes Buch.“ Insgesamt sechs deutsche Übertragungen von Moby-Dick gibt es inzwischen, die neueste stammt von Friedhelm Rathjen (2016 im Verlag Jung und Jung).
Mit dem Band Meistererzählungen hat der Diogenes Verlag die Lücke zwischen Melvilles Romanen geschlossen. Mit seinen Erzählungen, die Melville in den Jahren 1853 bis 1856 in verschiedenen Literaturzeitschriften veröffentlichte, wurde er noch am ehesten bekannt. Die vorliegende Auswahl versammelt insgesamt sechs recht unterschiedliche Erzählungen. Die Auftaktgeschichte Die Veranda erzählt zum Beispiel von einer märchenhaften Reise durch ein Elfenland. In Benito Cereno dagegen begegnet im Jahre 1799 einem amerikanischen Robbenfängerschiff ein merkwürdiges spanisches Handelsschiff mit seltsamen Gestalten, darunter der junge Spanier Don Benito. Melville gestaltete hier das Verhältnis von eigener und fremder Kultur unter dem besonderen Gesichtspunkt der Sklaverei. Der Band, der auch die Erzählung Bartleby enthält, wird durch ein aufschlussreiches Nachwort des Germanisten Hans-Rüdiger Schwab ergänzt, das 1991 anlässlich des 100. Todestages von Herman Melville in der Süddeutschen Zeitung erschien.
Die dritte Diogenes-Jubiläumsausgabe präsentiert Melvilles letzten Roman Billy Budd, den er erst wenige Monate vor seinem Tod verfasst – vollendet? – hatte. Die Handlung ist im englisch-französischen Seekrieg von 1797 angesiedelt. Der junge und pflichtbewusste Vortoppmann Billy Budd dient in der Britisch Royal Navy. Grundlos der Meuterei bezichtigt, erschlägt er im Affekt einen Kumpan und nach seemännischen Prinzipien lässt ihn sein geliebter Kapitän Vere hinrichten. Vor seinem Tode ruft der unschuldige Billy noch: „Gott segne Kapitän Vere“. Der vielschichtige Roman ist eine rätselhafte Geschichte über Schuld und Sühne. Die vorliegende Diogenes-Ausgabe wird durch ein Essay von Albert Camus vervollständigt. Billy Budd diente dem englischen Komponisten Benjamin Britten (1913–1976) als Vorlage für seine gleichnamige Oper (1951), die mit ihrer Auseinandersetzung der moralischen Konflikte längst zum festen Opernrepertoire gehört.
In der beliebten Insel-Bücherei ist zum Jubiläum Bartleby, der Schreiber in einer Übersetzung von Jürgen Krug aus dem Jahr 2004 erschienen, die ursprünglich noch mit Kommentaren versehen war. Die skurrile Erzählung hat Sabine Wilharm mit farbigen Illustrationen ausgestattet, die die stupide Welt der Bürokratie und Bartlebys Verweigerung bildhaft hervorheben.
Der Übersetzer Rainer G. Schmidt legte bereits 1997 eine Übertragung von Mardi und eine Reise dorthin vor, für die er viel Anerkennung erhielt, unter anderen wurde er mit dem Paul-Celan-Übersetzerpreis 1998 ausgezeichnet. Zum 200. Geburtstag Melvilles liegt sie nun, sorgfältig durchgesehen und korrigiert, in einer prachtvollen Ausgabe im Manesse Verlag vor. Die Übersetzung des grandiosen und irgendwie befremdlichen 800-Seiten-Romans ist glänzend und wird durch die Nachbetrachtung Atoll-Tollheiten – Notizen zu Mardi ergänzt. Dazu gibt der Übersetzer in rund 600 Fußnoten erläuternde Kommentare.
Bereits im März erschien mit Herman Melville – Leben in Bildern im Deutschen Kunstverlag ein Bild-Text-Band, in dem der Kunsthistoriker Thomas David dem Moby-Dick-Autor über die Stationen seines weitläufigen Werkes folgt. Zunächst sucht er Melvilles Grab auf dem Woodlawn Cemetery auf – daneben die Grabsteine seiner Frau Elizabeth, der beiden Söhne und einer Tochter. Andere Stationen sind der New Yorker Hafen sowie Melvilles Arbeitszimmer in „Arrowhead“ („Ich stand in dem Zimmer und blickte aus dem Fenster. An der Wand ein hängendes Foto des gespaltenen Baums, der Melville zur Figur des Kapitän Ahab inspiriert haben soll.“) Neben Melvilles Werken dienen alte Seekarten und die zweibändige Dokumentation The Melville-Log. A Documentary Life of Herman Melville 1819–1891 (1951) als Quelle für Davids Spurensuche, die er mit Notizbuch oder Aufnahmegerät festhält. Stets versucht er, sich in die Gegenwart von Melville einzufühlen. Die persönliche Melville-Annäherung ist außerdem mit zahlreichen historischen Abbildungen und einer Zeittafel versehen. Trotz zahlreicher Biografien (in den letzten Jahren von Arno Heller (2017), Andrew Delbanco (2005, dt. 2007) oder Daniel Göske (2004)) wirft Melvilles Leben aber bis heute noch vielerlei Rätsel auf.
|
||||||||||||