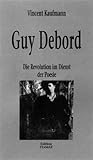Von J'accuse zu Jacuzzi
Ermittlungen in intellektuellen Angelegenheiten
Von Jörg Auberg
Drôle de drame
"Bordelle des Geistes" nannte Honoré de Balzac in seinem Roman Verlorene Illusionen" (1837-43) jene Agenturen der Verkäuflichkeit, die gemeinhin unter dem Etikett "Feuilleton" firmieren. Stieß man dort früher auf mehr oder weniger unerquickliche Soldknechte, trifft man dort - schenkt man dem Feuilletonchef der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" Glauben - neuerdings einen anderen Typus an. "Wir sind die Intellektuellen [...]", konstatiert Herr Jessen in der ihm eigenen Bescheidenheit und nimmt für sich einen "Heroismus" in der Selbstbehauptung in Anspruch. Es ist schon bizarr, mit welcher Frechheit zeitgenössische Wiedergänger der Etienne Lousteaus und der übrigen kleinmütigen und opportunistischen Lohnschreiberlinge, Zeitgeistschranzen und Tremulanten der Holtzbrinck-Kultur sich zu intellektuellen Heroen aufschwingen, als träten sie jeden Donnerstag für die Unterdrückten ein. Doch ist diese Unverschämtheit eher eine Reminiszenz an die skrupellose Ellbogen-Kultur der achtziger Jahre (als eine Kaffeemarke mit dem Slogan "Frech kommt weiter, sagt Hubert" für sich warb) denn eine faktentreue Beschreibung der gängigen Feuilleton-Praxis.
Kinder des Olymps oder Die Hölle sind die anderen
So ist Michel Winock zu danken, dass er mit seinem (erstmals 1997 in Frankreich erschienenen) dickleibigen Wälzer "Das Jahrhundert der Intellektuellen" die wahre Geschichte auch den Nachgeborenen in Erinnerung bringt, obgleich der Titel mehr verspricht als das Buch hält, denn es behandelt ausschließlich das Jahrhundert der französischen Intellektuellen, beginnend mit jener Affäre um den Hauptmann Alfred Dreyfus, der 1894 fälschlicherweise wegen Spionage zu lebenslanger Haft auf der Teufelsinsel Cayenne verurteilt wurde. Dies war der Ursprung des modernen Intellektuellen, symbolisiert durch den Romancier Émile Zola, der als "Dreyfusard" Partei für den jüdischen Hauptmann ergriff und der Öffentlichkeit seines enragiertes "J'accuse" entgegen schleuderte, während rechte Intellektuelle wie Maurice Barrès die Affäre als Angriff auf die französische Nation interpretierten. In dieser Zeit wurde der Begriff "Intellektueller" zum Schimpfwort für Leute, "die in den Laboratorien und den Bibliotheken leben", eine "Art Adelskaste" bilden, sich jedoch in Dinge einmischen, die sie nichts angehen. Für Barrès wusste der Intellektuelle nicht, "was Instinkt ist, Tradition, Liebe zur Scholle, alles, was eine Nation aus Fleisch und Blut ausmacht". Bereits in dieser Geburtsstunde des "engagierten Intellektuellen" bildeten sich jene Grundmotive heraus, die seit jeher in der Kritik gegen den kritischen Intellektuellen von rechter und nationaler Seite in Stellung gebracht werden: Die Intellektuellen bildeten eine neue aristokratische Kaste, seien inkompetent und setzten sich elitär von der "Masse" ab. Vor allem das Letztere ist eine der populärsten Spielarten des Antiintellektualismus: In seiner 1992 erschienen Studie "The Intellectuals and the Masses" ("The Intellectuals Against the Masses" wäre der passendere Titel gewesen) interpretierte der Historiker John Carey die gesamte englische literarische Moderne als Unternehmen der Intellektuellen, die herrschende Kultur gegen den Mob und die Massen abzuschotten. Zusätzlich kommen in der Dreyfus-Affäre noch Antisemitismus und Nationalismus als Triebkräfte ins Spiel: Für die Rechte waren Juden, Protestanten und Freimaurer am verschwörerischen Werke, um die Nation zugrunde zu richten. Auch dies sind der Grundmuster einer national grundierten Paranoia, die der liberale Historiker Richard Hofstadter bereits zu Beginn der sechziger Jahre als Motive von Rechtspopulisten in den USA beschrieben hatte.
Es gehört zu Winocks Verdiensten, dass er mit dem Mythos aufräumt, die Sache der "Dreyfusards" sei eine Passion der französischen Intellektuellen gewesen: Tatsächlich hatte die gesamte Académie française (bis auf Anatole France) gegen Dreyfus Stellung bezogen. Dagegen waren linke und gesellschaftskritische Stimmen, wie sie die Sozialisten Jean Jaurès und Léon Blum repräsentierten, zwar prominent, übten jedoch kaum einen hegemonischen Einfluss auf die politische und intellektuelle Kultur des Landes aus. Bestimmender waren eher rechte Protagonisten wie Charles Maurras, der mit seiner Phobie gegenüber allem Fremden und seinem Gefühl der Dekadenz der "Masse" der Franzosen weitaus näher war als die linken Internationalisten und Kosmopoliten. Der erste Weltkrieg besiegelte schließlich auch das Scheitern der internationalen Arbeiterbewegung, der die nationale Hose näher war als das proletarische Hemd. "Die Kriegserklärung war in gewisser Weise eine Revanche des antidreyfusistischen Nationalismus", kommentiert Winock: "die Armee wurde wieder heilig, der Kult der Nation bedeutete eindeutig, den antideutschen Hass zu schüren [...]."
Ein Vorteil des Buches ist zugleich sein Nachteil: Über die Distanz von mehr als 800 Seiten und 62 vorwiegend im Präsens gehaltenen Episoden kann Winock das Interesse für das Erzählte aufrecht erhalten, ohne in zähe Langeweile abzudriften. Zugleich aber wird Geschichte zur Guckkastenbühne, auf der der Historiker als allgegenwärtiger Augen- und Ohrenzeuge agiert. "Barrès gesteht Blum seine Bewunderung für Zola [...]", flüstert er einmal dem Publikum zu, und das ideologische Kommentieren wird um so penetranter, je einflussreicher die Rolle der Kommunisten nach dem ersten Weltkrieg ausfiel. "In der zerrütteten Welt der Nachkriegszeit glänzte die russische Revolution wie ein neuer Stern", weiß er zu berichten. "Mehr als sechzig Jahre lang sollte sie den Westen faszinieren." Dies ist freilich bloße antikommunistische Kolportage, die dem Mythos gehorcht. Bereits in den frühen zwanziger Jahren hatten prominente Anarchisten wie Emma Goldman und Alexander Berkman ihre Desillusion mit dem "sowjetischen Paradies" publiziert, und in den späten dreißiger Jahren hatte Bruno Rizzi seine Theorie des "bürokratischen Kollektivismus" in Paris veröffentlicht, die zunächst vor allem in trotzkistischen Kreisen diskutiert wurde. Dass die Oktoberrevolution die Welt mehr als sechzig Jahre fasziniert habe, entspricht kaum den historischen Tatsachen, denn spätestens die Enthüllungen Chrutschows über die von Stalin und anderen zu verantwortenden Verbrechen im Jahre 1956 leiteten das Ende des sowjetisch geprägten Kommunismus im Westen ein. Widersprüchlichkeiten im historischen Terrain ebnet Winock jedoch mit seiner antikommunistischen Planierraupe ein. "Die Dreyfus-Affäre war der Sieg der kritischen Urteilskraft gewesen [...]", konstatiert der Historiker. "Die Geschichte der Weggefährten [der Kommunisten], die sich Anfang der dreißiger Jahre beschleunigte, liegt genau umgekehrt: der Anschluss der Intellektuellen beruhte ganz auf dem Glauben." Hierbei unterschlägt Winock freilich, dass Intellektuelle im alten Europa keineswegs einer neuen Glaubensrichtung folgten, sondern nach unbeschreiblichen Massakern auf den Schlachtfeldern des Krieges den Bruch mit einer gescheiterten Zivilisation suchten.
Symptomatisch für die Suche nach einer Alternative waren die Biografien von Pierre Drieu La Rochelle und Paul Nizan: Der eine ist als desillusionierter Dandy auf der Suche nach einer idealen Mischung aus Nationalismus und Sozialismus und endet im Faschismus, während der andere den Marxismus als Grundlage seiner Gesellschaftskritik nimmt, die akademischen Intellektuellen als Wachhunde der Herrschaft kritisiert und schließlich gegen den Stalinismus rebelliert. Während Winock dem Autoren von "Le feu follet" großen Raum bietet und ihn als irregeleiteten Intellektuellen porträtiert, der alternativ den Weg eines kommunistischen Weggefährten hätte beschreiten können, wird Nizan als Nebendarsteller abgefertigt, der vor allem als Alibi-Intellektueller zu dienen hat, der vom französischen Stalin-Stellvertreter Maurice Thorez als Verräter an den Pranger gestellt wird. "Im Allgemeinen theoretisieren die Intellektuellen nachträglich ihre Parteinahmen und Distanzierungen, indem sie ihre Gründe objektivieren", doziert Winock. "Auf einer tieferen Ebene reagieren sie eher, als dass sie agieren; in ihrem politischen Engagement suchen sie sich eher selbst zu verwirklichen, als die Welt zu verändern." Darin unterscheiden sich jedoch die Intellektuellen kaum von ihren übrigen Zeitgenossen.
Während die "stalinistisch" verseuchten Intellektuellen jener Jahre an den Pranger gestellt werden, kommt der Vorzeige-Intellektuelle der Volksfront vergleichsweise milde davon. André Malraux ist die Verkörperung des "engagierten Schriftstellers", der sich in den Dienst des Antifaschismus stellt, gleichzeitig aber auch immer das eigene Fortkommen sichert, als Intellektueller vor der Öffentlichkeit posiert, im Spanischen Bürgerkrieg in der Uniform des Chefs der republikanischen Luftwaffe sich zur Schau stellt oder im zweiten Weltkrieg den militärischen Erfüllungsgehilfen des Generals de Gaulle mimt. Letztlich mutiert Malraux zum französischen Intellektuellen, der sich wie der aufgeplusterte Bourgeois in den Kulissen der kleinen Eitelkeiten aufspielt. Er wird zum Prototyp des Medien-Intellektuellen, geboren im ersten "Medien-Krieg" des zwanzigsten Jahrhunderts, dem Spanischen Bürgerkrieg, auf den im Laufe der vielen Kriege des Jahrhunderts eine besondere Garde des Intellektuellen-Typus folgt: Im Fin de Siècle entsteigen dem Kochtopf der intellektuellen Nouvelle Cuisine ehemalige Kannibalen der Weltrevolution wie André Glucksmann und Bernard-Henri Lévy, um die medienwirksame Werbetrommel für gänzlich entwertete Menschenrechte und das eigene Fortkommen im Betrieb (und hierin liegt der zentrale Unterschied zu Zola) zu rühren. Diese Entwicklung streift Winock jedoch lediglich im Vorbeigehen, denn offenbar passen diese Passanten oder Straßenpaare nicht ins Schema eines stringenten Antikommunismus. Die Hölle - das sind die anderen.
Nach der Befreiung von der faschistischen Okkupation zog die Kommunistische Partei ein hohes Prestige aus ihrer führenden Rolle in der Résistance und nahm ihre Rolle als Statthalter der stalinistischen Macht wahr, während die Utopie einer "neuen Linken", wie sie Albert Camus, Nicola Chiaromonte, Dwight Macdonald und andere Intellektuelle unmittelbar nach dem Ende des zweiten Weltkrieges erträumten, zwischen den neuen Fronten des Kalten Krieges aufgerieben wurde. Zweifelsohne versuchte die Kommunistische Partei Intellektuelle zu instrumentalisieren, doch war sie nicht die Hexe, in deren Wald sich arglose Geistesarbeiter wie Hänsel und Gretel verirrten. Immer schon gehörten zur Verführung beide Seiten. In Winocks Erzählung liest es sich so: "Die Verführungskraft des Kommunismus hat bekannte Intellektuelle dazu bewogen, der Partei beizutreten; sie hat auch zweitrangige Intellektuelle angezogen, die auf der Suche nach einer Stellung, nach Ehre und öffentlichem Echo sind." Monolithisch ragt die Partei als Riff im Meer der Verirrungen auf, während die übrigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Komplexe dahinter verschwinden. Die Kommunistische Partei erscheint als Racket in der Gesellschaft (das sie zweifelsohne war), die auch den intellektuellen Integrationswilligen eine Heimstatt bot, doch unterschlägt Winock die Tatsache, dass es eine Gesellschaft war, die einzig in Rackets sich organisierte. Belügen musste sich nicht nur der kommunistische Intellektuelle, sondern alle in der Gesellschaft mit ihren falschen Versprechungen. Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir werden als "Pop-Intellektuelle" vorgeführt, während als einziger Repräsentant intellektueller Integrität Raymond Aron zu gelten hat. "Nichtsdestoweniger ist Sartre Anfang der achtziger Jahre der irregeleitete und Aron der luzide, sich-niemals-geirrt-habende Intellektuelle", resümiert Winock. "Der eine hat immer nur das Unmögliche erträumt, der andere wird mit dem Lorbeerkranz der Vernunft des Machbaren gekrönt." Der eine ist der Tom Sawyer der französischen Intellektuellen, während dem anderen lediglich der Part des musterknabenhaften Bruder Sid bleibt. Sid war bis zur drögen Selbstverleugnung vernünftig, während Tom die Abenteuer mit Becky Thatcher und Injun Joe erlebte.
Das große Manko dieses Buches ist die Personalisierung der Geschichte: Nicht ökonomische, politische oder kulturelle Faktoren, gesellschaftliche Institutionen oder Interessengemeinschaften bestimmen, welche Richtung die Entwicklung nimmt, sondern einzelne, angebliche herausragende Intellektuelle. In der Erzählung Winocks vollführte der antikommunistische "Kongress für die Freiheit und Kultur" einen heroischen Kampf gegen die Sowjet-Herrschaft, dessen treibende Kräfte Melvin J. Lasky, Sidney Hook und James Burnham gewesen seien. Mit keinem Wort erwähnt Winock die Tatsache, dass der Kongress über heimliche Konten der CIA bis in die sechziger Jahre hinein finanziert wurde. Dominierende Zeitschriften wie die "Partisan Review" (ironischerweise 1934 im Orbit der New Yorker Kommunistischen Partei gegründet), "Der Monat", "Encounter", "Preuves" und "Tempo Presente" bezahlten ihre Honorare über Schwarzkonten des amerikanischen Geheimdienstes. Noch im Nachruf auf den jüngst verstorbenen Ex-Trotzkisten und antikommunistischen Lautsprecher Lasky versucht der Herausgeber der "Zeit", Michael Naumann, diese Geschichte mit dem Hinweis zu bagatellisieren, dass CIA-Gelder auch an die SPD und den DGB flossen. Als die linke Zeitschrift "Ramparts" 1967 jedoch diesen Sachverhalt aufdeckte, war das Geschrei - vor allem auf Seiten der Honorierten, die angeblich von den finsteren Quellen nichts wussten - groß, und die Finanzierung durch den Geheimdienst schädigte die Reputation der betroffenen Intellektuellen nachhaltig.
Ebenso wenig erhalten die Jahre nach 1968 Winocks Aufmerksamkeit. Immer enger fokussiert sich der Blick des Historikers auf den Intellektuellen, der immer Recht hatte: Raymond Aron. Und offenbar interessiert sich Winock kaum für die Ereignisse des intellektuellen Frankreichs der letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Die turbulenten Tage des Mai 1968 "kommen völlig unerwartet, und es ist nicht einmal sicher, ob sie bei all ihrer dramatischen Intensität überhaupt einen tief greifenden Einfluss auf die französische Gesellschaft und ihre Institutionen ausgeübt haben", doziert er. Im "Jahrhundert der Intellektuellen" scheinen sie zumindest eine zu vernachlässigende Episode zu sein. Schließlich endet die Ära mit dem Wahlsieg Mitterrands, den Winock mit den Stimmen der Kommunisten erkauft sieht, während Michel Foucaults Spitze des "spezifischen Intellektuellen" gegen Sartres Konzeption des "universellen Intellektuellen" en passant erledigt wird. Und am Ende wird Aron als Modell des Intellektuellen gefeiert - ein Intellektueller, der wie kaum ein anderer seiner Zeit verhaftet blieb und keinen Ausblick auf die Zeit nach ihm verschaffte. Scheinbar endete die Geschichte zu jenem Zeitpunkt, als Aron in die höheren geistigen Sphären der Vergänglichkeit abberufen wurde. Und danach konnte nichts mehr kommen. Der Vorhang fiel, und das Theater sackte in sich zusammen.
Klandestine im Café Größenwahn
In Winocks allzu konventionell geratener Geschichte der Intellektuellen erhalten die üblichen Verdächtigen (Geistesgrößen, Nobelpreisträger und intellektuelle Rackethäuptlinge) die ihnen zweifelsohne angemessene Beachtung, während andere, unbekanntere Figuren wie Guy Debord (1930-1994), der theoretische Kopf der Situationisten und Autor des legendären Buches "Die Gesellschaft des Spektakels" (1967), lediglich einmalige Erwähnung im Nekrolog finden. Diese Lücke verspricht die Debord-Biografie des an der Universität St. Gallen lehrenden Professors Vincent Kaufmann zu schließen, doch scheitert der Biograf kläglich an seinem Unterfangen. Die zweifellos interessante Figur des klandestinen Intellektuellen Debord, der 1994 seinem Leben vorzeitig ein Ende setzte, vermag er nicht entlang seinen Traditionslinien, Brüchen und Widersprüchen zu porträtieren. Stattdessen stülpt er der Geschichte ein eindimensionales Szenario über, in dem Debord als Saint Guy, als dehistorisierter Super-Intellektueller erscheint, heimgesucht von nichtswürdigen Kritikastern, die seine Ideen nicht verstehen und in den Schmutz ziehen. Debord erscheint als Wiedergänger von Balzacs Daniel d'Arthez, der allen Verlockungen des Marktes widersteht, am Ende doch den Weg von den Agenturen der Obskurität ins Pantheon des französischen Ideenmarktes findet und sein Œuvre - die vorgeblichen "Anti-Bücher", die sich der Rezeption "gewöhnlicher" Leser, die als "Störenfriede" empfunden wurden, entzogen - bei Gallimard für die Nachwelt verlegen lässt.
Kaufmann sieht Debord als Nachfahre der großen französischen Avantgardisten wie Baudelaire, Lautréamont und Mallarmé, die Literatur von Klandestinen für Klandestine produzierten und die künstlerische Avantgarde als Agentur zur Selbstaufhebung und Realisierung der Kunst durch deren Abschaffung begriffen. All dies ist noch diskutabel, obwohl Debord in künstlerischen "Avantgarden" wie den Lettristen und Situationisten dominierte, die bestenfalls zweitrangig waren. Realiter führten sich diese Avantgardisten der Nachkriegswelt wie Kultur-Hooligans auf, die mit Gewalt ihren Platz in der Gesellschaft zu erobern suchten - ganz im Stile von Banden, die johlend und brüllend an den Häuserblocks vorbeiziehen und zufällige Opfer für ihr Entertainment selektieren. Kaufmann nennt es euphemistisch "Schmähung", als die Debord-Gang Charlie Chaplin, der vor antikommunistischen Repressionen in den USA floh, mit einem wüsten Pamphlet empfing, in dem er als "verkappter Faschist" beschimpft wurde. Im gleichen Stil wüteten die selbst ernannten Avantgardisten gegen ihre Vorläufer, die Surrealisten - wie eine Straßengang, die dem urbanen Terrain ihre Signatur aufzudrücken sucht, wie es im situationistischen Argot hieß.
Nicht allein die bornierte, eindimensionale Verteidigung Debords im Stile eines verschlagenen Winkeladvokaten ist Kaufmann anzulasten, sondern ein penetranter bellizistischer Jargon, der in einer faschistoiden Verherrlichung von Krieg und Gewalt mündet. Es wimmelt von Brigaden, Bataillonen und Kriegern, während es sich doch lediglich um eine marginale Avantgarde handelt, die ihre Scharmützel im Stile humorloser Slapstick-Komiker inszenierte. Doch Kaufmann, der zwischen schwülstigem Revoluzzer-Pathos und akademischer Dampframmen-Rhetorik changiert, nimmt das Geschehen anders wahr. Die Situationisten, heißt es an einer Stelle, "begnügen sich damit, die Zünder für bereits existierende Bomben anzufertigen und ermöglichen es diesen zu explodieren [...]", während er Debord als "Krieger" zeichnet: "Das Wort steht für Debord nicht nur im Dienste des Krieges oder der Revolution, es wird selbst zum Ort oder zur treibenden Kraft des Krieges." Und an anderer Stelle rühmt der Luzerner Professor Debords "kriegerische Beziehung zum Leser oder Publikum". So geht intellektuelle Geschichte in dumpfe Landser-Prosa über.
Darüber hinaus sind Kaufmanns sprachliche Unzulänglichkeiten wie "Nichts ist falscher" oder "Besonders wahr ist" eine Zumutung für den Leser, und passagenlange Redundanzen, die dem Auge eines kritischen Auge eines Lektors nicht hätten entgehen dürfen, stellen harte Prüfungen für die Leidensfähigkeit des Lesers dar. Kaufmann ist unfähig, einen Spannungsbogen aufzubauen, weil alles ins Schema sich zu integrieren hat und das Ressentiment gegen alle Kritiker und "Abweichler" ständig aus ihm herausbricht. In Goebbelshafter Manier belegt er die Kritik mit einem Verstummungsverdikt: Niemand habe das Recht, den Situationisten-Führer zu kritisieren, denn nur er habe in seiner genialen Einzigartigkeit die Dinge beim Namen nennen können. "Die, die sich erdreisten [trotz allem Kritik zu üben], tun es, um ihre Opposition zu der von Debord vorgebrachten Gesellschaftskonzeption zu kaschieren, um die Wirklichkeit des Krieges zu verwischen, den dieser führt, und vor allem, um nicht sagen zu müssen, in welchem Lager sie selber stehen [...]." Vielleicht erkennt man die Delinquenten, welche die Autorität des Führers Saint Guy in Zweifel ziehen, an ihren eintätowierten Häftlingsnummern, und dann ließe sich auch feststellen, in welchem Lager sie stehen.
Für Kaufmann ist Debord offensichtlich der größte Künstler des 20. Jahrhunderts. Der Film "Geheul für de Sade" (1952) mit seinem Übergang ins schwarze Filmstreifen scheint für ihn das Nonplusultra der Moderne zu sein, obwohl nahezu alle Avantgarden in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg an der Abschaffung der Kunst und der eigenen Ablösung arbeiteten. Symptomatisch war William Burroughs mit seiner "Nova-Trilogie", in der der Slogan "Rub out the word, and the image track goes with it" ständig wiederkehrte. Aber darauf rekurriert der Kriegsberichterstatter Kaufmann natürlich nicht, denn dies würde die vorgebliche Einzigartigkeit Saint Guys in Frage stellen. Debords Buch "Die Gesellschaft des Spektakels" stellt in der Tat einen wichtigen Beitrag in der kritischen Theorie dar. In einer vollkommen technisierten, von allgegenwärtigen Bildern und Tönen der Herrschaft gänzlich durchdrungenen Welt, wo Illusion und Realität ineinander überblendet wurden und das Spektakel, als Ausdruck der ubiquitär vollendeten herrschenden Produktionsbedingungen, selbst ins Innere der Menschen einmarschiert war, sollten - so lautete Debords Kernthese im Vorjahr des Mai 1968 - die Arbeiter die Situation "detournieren", indem sie mittels revolutionärer Aktivitäten die verkehrten Verhältnisse auf den Kopf stellen, Kontrolle über den urbanen Raum errangen und das eigene Leben selbst organisierten. Debords 221 Thesen zur "Gesellschaft des Spektakels" entstanden nicht im luftleeren Raum, sondern bezogen Einflüsse von den rätesozialistischen Ideen der Gruppe "Socialisme ou Barbarie", Henri Lefèbvres "Kritik des Alltagslebens" und vor allem Georg Lukács' Verdinglichungstheorie. "Lukács hatte immer die Existenz von "Vermittlungen" innerhalb der Totalität, Formen der Einheit innerhalb der Differenz vorausgesetzt", kritisierte der englische Filmtheoretiker Peter Wollen 1989 in einem Essay in der "New Left Review", "aber Debords maximalistische Vision suchte jegliche "Trennung" abzuschaffen, Subjekt und Objekt, Praxis und Theorie, Basis und Überbau, Politik und Verwaltung, in einer einzigen unvermittelten Totalität zu vereinigen."
Bezeichnenderweise nimmt Kaufmann keinerlei Kritik wahr. Für ihn ist die "Die Gesellschaft des Spektakels" ein Buch, "an dem es nichts auszusetzen gibt, eines, durch das alles gesagt ist." Er unternimmt keinerlei Anstrengungen, zu erläutern, was unter Lettristen und Situationisten zu verstehen ist, was Debord in seinen Thesen darzustellen versucht. Ein Insider schreibt für Insider, die bereits alles wissen und auf die ultimative Lobhudelei, die auf die Spitze getriebene Führer-Idolatrie warten. So stellt er sich die Frage, ob man in Debord "gar einen großen Schriftsteller sehen" müsse, um sogleich die passende Antwort zu erteilen: "Da ich nicht weiß, was ein großer Schriftsteller ist, werde ich mich hüten, diese Frage zu beantworten." Wenn er keine Kriterien bezüglich der Kategorie "Großer Schriftsteller" besitzt, erübrigt sich diese Zeilenschinderei. Umso besser weiß er, dass Henri Lefèbvre (der sowohl in der stalinistischen Anschwärzung Paul Nizans eine unrühmliche Rolle spielte als auch einigen situationistischen Ideen sein unberechtigtes Copyright aufzustempeln suchte), ein Schweinehund war und walzt die Anprangerung seiner Schweinehündigkeit in ermüdenden Passagen aus.
In Erinnerung bleibt Debord als Leader der Situationistischen Internationale (SI), in der er in typischer Racket-Manier missliebige Kontrahenten über die Planke springen ließ: Wer dem Kommando des Racketeers nicht willfahrte, wurde aus dieser obskuren Internationale ausgeschlossen. Die "Revolutionäre", die jedes Argument gegen Bürokratie und Verwaltung, in der Tasche hatten, waren Virtuosen der Geschäftsordnungen und Hammelsprünge, die für klare Verhältnisse in ihrer Organisation sorgten und den einen oder anderen "entsorgten". Auch hier kann Kaufmann nichts Kritikwürdiges entdecken: "Groß ist die Zahl der Ausgeschlossenen, doch noch viel mehr haben nicht einmal dieses Glück gehabt, da sie ja erst gar nicht [in die SI] aufgenommen wurden." Vehement bestreitet er, dass die SI eine elitäre Organisation gewesen sei, und im Übrigen hätten die Ausgeschlossenen "dicht gehalten", schreibt er im verräterischen Racket-Jargon. Mit Konkurrenten sprang Debord nicht anders um als Gamaschen-Colombo mit Zahnstocher-Charlie, während Kaufmann den typischen Situationisten als Consultant beschreibt: "Die wirklichen Revolutionäre wissen sich vergessen zu machen, zu verschwinden, verloren zu gehen." Aus diesem Grunde hat Professor Kaufmann ein Buch über Debord und dessen "Berufung zur Obskurität" geschrieben. Tatsächlich ist das große Glück, dass Debord in der Obskurität verharrte und nicht als intellektueller "Krieger" eine Bühne zur realen Selbstinszenierung erhielt. Wäre Frankreich zu Zeiten des Algerien-Krieges in einen Bürgerkrieg gestürzt, hätte man sich Debord mit seinen Racketeer-Allüren gut als Modell "Gamsachurdia" vorstellen können, das später in Georgien seine Premiere feierte, in der ein entfesselter Shakespeare-Übersetzer (ein Intellektueller im weiteren Sinne) seine Machtgelüste für kurze Zeit in der Realität ausleben konnte, ehe er in den Wirren eines Bürgerkrieges selbst sein Leben verlor. Doch Kaufmann ist unbeirrbar: Die Wahrheit der Thesen Debords, deklamiert er zum Schluss, "liegt in der Wahrheit seines Gewaltstreichs, seiner absoluten Disqualifizierung des Blicks des Anderen; es ist die Wahrheit einer Weigerung und die steht nicht zur Diskussion, wird nicht widerlegt." Immerhin ist es tröstlich, dass der Wahn sich in diesem Fall auf eine intellektuelle Fantasie beschränkt, die glücklicherweise nicht reale Macht entfalten konnte.
Der Intellektuelle als Cineast
Auch Jean-Luc Godard stand auf der schwarzen Schmähliste der Situationisten, die Kaufmann genüsslich zitiert - und zwar als der "dämlichste aller prochinesischen Schweizer", da er dem Führer Debord nicht jene Ehrerbietung zollte, wie es sich ziemte. Debords Leben überschattete Godards, schreibt Colin MacCabe in seiner Biografie "Godard: A Portrait of the Artist at 70". Der eine entschied sich für die Revision der Moderne, während der andere vorgeblich mit allen bürgerlichen Konventionen brach, um die herrschende Ordnung zu desorientieren. Tatsächlich aber dominierten sektiererische Streitereien und ein pseudoradikaler "Hyper-Intellektualismus", der Godard von Debord unterschied. Während Debord sich als Krakeeler im Café Größenwahn aufspielte und als filmischer Dilettant sich in einer Reihe mit Georges Méliès, René Clair, Luis Buñuel und Charlie Chaplin stellte, näherte sich der in der Schweiz geborene und aufgewachsene Godard dem Medium verhaltener und vorsichtiger. Der "Godardologe" MacCabe führt Godard keineswegs als großes Genie vor. Vielmehr legt er einige unangenehme Seiten des "Großen Modernisierers" des europäischen Kinos offen: In seiner Jugendzeit trieb Godard das neurotische Verlangen des Stehlens voran, das ihn für kurze Zeit ins Gefängnis brachte. Selbst vor der Portokasse der Filmzeitschrift "Cahiers du Cinéma" schreckte Godard nicht zurück, woraufhin der cineastische Dieb für einige Zeit das Weite suchen musste.
Trotz dieser Verfehlungen mutierte Godard in den sechziger Jahren zu den revolutionären Ikonen des modernen Kinos. Neben Alexander Kluge, Emile de Antonio, Francesco Rosi und Fernando Solanas war er der Inbegriff des cineastischen Intellektuellen, der das Kino als Spielort des Universalismus (der Literatur, Malerei und Emanzipation) begriff. Am Ende integrierte Godard in seiner Version des Autorenfilms Literatur, Musik, Malerei, Comics, Töne und Bilder, versuchte ein Publikum zu finden, das seinen Theorien und Ansprüchen genügte. Am Ende beziffert Godard dieses Publikum auf "100.000 Freunde rund um die Welt". Die Biografie ist ein Supplement zu MacCabes Standardwerk "Godard: Images, Sounds, Politics" (1980) und zeichnet Godards Entwicklungen vor allem entlang der Linien der Beziehungen zu jenen Frauen, die nicht allein sein Film-, sondern auch sein Lebenswerk prägten. Nach seinem außerordentlichen Debüterfolg "A bout de souffle" (1960) dominierte die dänische Schauspielerin Anna Karina die erste Periode seines Filmschaffens. Nachdem sich beide auseinander gelebt hatten, spielte Anna Wiazemsky, die Enkelin des konservativen Intellektuellen François Mauriac, die entscheidende Rolle in den Filmen, die in der Zeit um die Ereignisse des Mai 1968 entstanden. Danach wurde Anna-Maria Miéville, eine Schweizer Filmemacherin, für die folgenden Jahre bis heute zur zentralen Mitarbeiterin.
MacCabes Leistung liegt nicht allein in der Tatsache, dass er dem bedeutendsten Filmemacher aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts eine längst fällige Biografie widmet, sondern Godard als beispielhaften Cineasten ortet, der seinen Platz in der intellektuellen Geschichte hat, als einen "auteur manqué", einen Essayisten im Stile Montaignes, der über vier Jahrzehnte hinweg eine konsequente (Selbst-) Kritik der visuellen Medien (Fotografie, Film und Video) forcierte. MacCabe nennt Winocks Studie "eindrucksvoll", moniert aber zugleich - mit vollem Recht - die fehlende Einbeziehung der wichtigsten Kunst des 20. Jahrhunderts: des Kinos. Daher liefert der britische Filmologe die wichtigen Ergänzungen zu Winocks voluminösem Band.
Der zum linkskatholischen Milieu um die Zeitschrift "Esprit" gehörende Filmkritker André Bazin verglich Stalin mit Tarzan und beging damit in den Augen der Stalinisten einen blasphemischen Akt. Die "Cahiers du Cinéma" wurden schnell zur wichtigsten Filmzeitschrift, doch driftete sie vor allem durch Bazins Schüler François Truffaut zur Rechten. Für MacCabe ist Bazins früher Tod im November 1958 immer noch ein unersetzlicher Verlust, und filmische Monster-Unternehmen wie "Jaws" und "Tron" schafften nicht lediglich das "bazinistische" Kino des Realismus ab, sondern machten auch den Kritiker überflüssig. Zweifellos war Bazin eine überragende Figur als Filmkritiker, doch verfällt MacCabe einem ähnlichen Fehler wie Winock: Er überhöht Bazin zur monumentalen und heroischen Figur im ökonomisch bestimmten Getriebe des Kinos, verklärt die Geschichte des Films bis zum "Sündenfall" des Spielberg-Blockbusters und unterschlägt die religiösen Implikationen der Invektiven Bazins gegen die Filmmontage. Vor allem ist nicht einsichtig, warum er die französische Einheitsfront von "Realismus" und "Illusionismus" aus der Frühzeit des Kinos - in Gestalt von Lumière und Méliès - gegen das amerikanische "Anti-Kino" der beiden Stevens (Spielberg und Lisberger) in Stellung zu bringen sucht. Hier schwört MacCabe eine heile "Kino-Welt" herauf, die so wenig mit der Realität zu tun hat wie Edwards Scherenhände mit der Welt der Behinderten.
Nichtsdestotrotz zeichnet MacCabe Godards Weg vom amerikanophilen Kino-Maniac zum kritischen Kino-Intellektuellen eindrucksvoll nach, der seit Mitte der sechziger Jahre in jedem Film den Vietnamkrieg thematisierte und eine generelle Kritik gegenüber der herrschenden Medienindustrie artikulierte, die er als fusioniertes Global-Unternehmen "Hollywood-Cinecittà-Mosfilm-Pinewood" agieren sah. Zunehmend bewegte sich Godard - zu Beginn seiner Karriere noch als Rechter verschrien - auf die radikale Linke zu, die vehementer als andere gegen die Verknöcherungen des autoritären französischen Staates aufbegehrte. Symptomatisch war die staatsstreichartige Absetzung des Leiters der Cinémathèque Française, Henri Langlois, durch den gaullistischen Kulturminister Malraux. Langlois hatte für die Nachkriegsgeneration die Geschichte des Kinos eröffnet und wurde von einem Moment zum anderen auf die Straße gesetzt. Dagegen protestierten nicht allein Langlois-Adepten wie Godard und Truffaut, sondern die gesamte Cineasten-Weltgemeinschaft (von Kurosawa über Rosselini bis zu Chaplin) ging gegen diesen Affront auf die Barrikade.
Dies war der Vorbote der Mai-Revolte, in deren Verlauf sich Godard immer weiter vom Mainstream entfernte. Zusammen mit Anna Wiazemsky und Jean-Pierre Gorin sowie einigen anderen Getreuen rief er die "Gruppe Dziga Vertov" (benannt nach dem berühmten sowjetischen Dokumentarfilmemacher der zwanziger und dreißiger Jahre) ins Leben, die nach dem Mai 1968 eine Reihe von UVOs ("Unidentifizierten Visuellen Objekten" - Gorin) produzierte. Filme wie "Vent d'Est" (1969) waren durch einen extensiven ideologischen Didaktizismus gekennzeichnet, doch auch wenn sie im Grunde eine Tortur für den Zuschauer waren, entwickelten sie eine radikale Kritik der audiovisuellen Welt der Information, die noch immer ihresgleichen sucht. Zwar kann auch MacCabe keine schlüssige Erklärung dafür liefern, warum Godard - wie so viele andere - den "Gauchismus" wie eine zweite Haut rasch ablegen konnte, doch blieb die Radikalität der Medienkritik in späteren Video- und TV-Werken wie "Six fois deux" (1976) und "Histoire(s) du Cinéma" (1998) präsent.
Leider verliert sich MacCabe auf den letzten Seiten seiner Godard-Biografie - in postmoderner Manier - als selbstverliebte Figur im eigenen Werk, doch gelingt es ihm trotz allem, einen widersprüchlichen "ciné-intellectuel" erstehen zu lassen, der längst aus den Kinos verbannt worden ist. Symptomatisch ist, dass dieses Buch wohl niemals den englischen Kanal passieren wird - da selbst in den guten Zeiten für Filmbücher in diesem Land (in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren) lediglich die Konfektionsware mit einem Visum für den Binnenhandel ausgestattet wurde.
Il ne faut pas mourir pour ça
And now to some completeley different. "Im Lexikon der New Yorker Intellektuellen ist "Akademiker" immer ein Antonym zu "Intellektueller" gewesen", konstatierte Eugene Goodheart in den frühen neunziger Jahren in einem nostalgischen Rückblick auf die Gruppe jener Kritiker, Schriftsteller, Dichter und Journalisten, die sich um die New Yorker Zeitschriften "Partisan Review", "Dissent" und "Commentary" geschart und nach dem zweiten Weltkrieg den Weg von den kulturellen und politischen Außenbezirken in die akademischen Bürokratien gefunden hatten. Für Russell Jacoby stellten sie die letzte Generation von öffentlichen Intellektuellen dar, die den Kampf gegen die Akademisierung und Institutionalisierung verloren. Sein Essay "The Last Intellectuals", erstmals 1987 erschienen, ist mittlerweile ein Klassiker der intellektuellen Akademikerbeschimpfung und ist im Grunde eine zeitgemäße amerikanische Version von Paul Nizans Kritik der "Wachhunde", in der er zu Protokoll gab: "Wir leben in einer Zeit, in der die Philosophen sich aus den öffentlichen Angelegenheiten heraushalten. Sie leben in einem Zustand skandalöser Abgeschiedenheit." Für Jacoby waren in den achtziger Jahren die einstigen "radikalen" Intellektuellen der Neuen Linken die neuen Protagonisten dieses fortwährenden Skandals: Als die schärfsten Kritiker des universitären Betriebes in den frühen sechziger Jahren aufgebrochen, endeten sie als auf Lebenszeit bestallte Professoren, die sich in ihren akademischen Enklaven von den sozialen Realitäten abschotteten und einen Jargon sprachen, der von Außenstehenden kaum noch zu verstehen war. Diesen Prozess beschrieb der einstige SDS-Vorsitzende Todd Gitlin mit dem Bonmot "From J'accuse to Jacuzzi": Das Einzige, was sich in der erstarrten Vorstadtwelt der ehemaligen Bewegungsaktivisten noch bewegte, war der Whirlpool.
Im Vorwort zur Neuauflage seines Buches konzediert Jacoby, dass die in der Öffentlichkeit agierenden Intellektuellen keineswegs ausgestorben seien, und möchte seinen Essay als Aufruf zur Intervention verstanden wissen und keineswegs als antiintellektuelle Forderung nach "populären" und populistischen "Medienintellektuellen". Intellektuelle Arbeit habe aber nicht lediglich in abgezirkelten Räumen so genannter Elite-Universitäten stattzufinden, sondern müsse sich auch im öffentlichen Raum verständlich zu artikulieren. "Selbst der als schwierig verschriene Adorno schwitzte über seinen Radiovorträgen, um sicherzustellen, dass sie klar und verständlich wären." Obwohl Jacoby als amerikanischer Repräsentant der Kritischen Theorie nicht explizit auf Horkheimers Racket-Theorie eingeht, ist sein Buch doch eine glänzende Kritik der akademischen Rackets (nicht allein in den USA). "Das Racket kennt kein Erbarmen mit dem Leben außer ihm, einzig das Gesetz der Selbsterhaltung", schrieb Horkheimer in den frühen vierziger Jahren. "Unterm Monopol erstarrt die Sprache zu einem Zeichensystem, stummer und ausdrucksloser als Morsezeichen und Klopfsysteme von Gefangenen." Daher ist Jacoby auch ein scharfer Sprachkritiker, der mit beißendem Spott die Artikel der Racket-Akademiker zerpflückt. Apparatschiks wie Immanuel Wallerstein oder Fredric Jameson, die mit "marxistischem Voodoo" ihre Gefolgschaften zusammenhalten und wie eine Herde beliebig austauschbarer Konformisten von einem Kongress zum nächsten Symposion treiben, verkörpern für ihn das Scheitern der Neuen Linken, die ein kritisches Analyseinstrument in ein Werkzeug für den eigenen Machterhalt in Bürokratien und Institutionen egoistischer Interessengruppen umfunktionierte.
An Jacoby kann sich niemand, der in irgendeiner Weise in intellektuelle Angelegenheiten involviert ist, vorbeistehlen. Auch Michael Dennings Unterfangen, das Scheitern der Intellektuellen aus der Zeit nach dem Mai 1968 einerseits einzugestehen und andererseits ihren Erfolg in der Etablierung der "Cultural Studies" herauszustellen, ist nicht sonderlich überzeugend. Seine Essaysammlung "Culture in the Age of Three Worlds" ist in erster Linie der durchaus selbstkritische Versuch, die Bedingungen und Gründe für die Entwicklung der "akademischen Linken" in der Zeitspanne zwischen 1945 und 1989 aufzuzeigen. Nun ist es durchaus einsichtig, dass ein Yale-Professor nicht der These zustimmt, dass Intellektuelle durch akademische Rackets korrumpiert worden seien, und in Selbstverteidigung Kritikern eine Retro-Verklärung überholter Verhältnisse vorhält, doch hilft es wenig, wenn er ständig den alten Althusser-Ladenhüter von den "staatlichen Kulturapparaten", Gramscis Theorien über die "organischen Intellektuellen" und die "kulturelle Hegemonie" ausgräbt und als Gegenmodell einer "neuen" Öffentlichkeit eine seltsame Melange akademischer Fachjournale unter der Ägide mehr oder minder obskurer Universitätsverlage zu propagieren sucht. Ermüdend wird das - sonst in luzidem Stil gehaltene - Buch in solchen Passagen, in denen Denning die Leistungen der "kulturellen Linken" im Überblick herausstellen möchte, wobei es den Anschein hat, als wollte er den Leser durch eine ausgedehnte Plantage seiner Lesefrüchte treiben.
So hinterlässt Dennings Buch einen zwiespältigen Eindruck: In lichten Momenten stellt es Zusammenhänge in der intellektuellen Geschichte der letzten drei Jahrzehnte her, während es andererseits der mittelalterlichen Generation jetziger Akademiker versichert, dass sie alles schon richtig gemacht hätten. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Jacobys bêtes noires, Wallerstein & Jameson, ihre akademische Würdigung erfahren. Letztlich bleibt die postmoderne Erkenntnis: Alles ist Kultur, und alles unterliegt dem Grundsatz des "Anything goes". Zwar durchleuchtet Denning einige Aspekte der Globalisierung der Kultur nach dem zweiten Weltkrieg und fordert eine Wiedergewinnung der Demokratie durch Basisbewegungen als Antwort auf die antidemokratischen Tendenzen eines globalen Neoliberalismus, doch bleibt die Argumentation oft diffus und der Vergangenheit verhaftet. Tatsächlich ist Denning eher mit der proletarischen Literatur der zwanziger und dreißiger Jahre vertraut denn mit den kulturellen Entwicklungen der letzten Jahre. Obwohl die technischen Grundlagen für das World Wide Web bereits im Jahre 1969 geschaffen wurden, geht er auf die Auswirkungen, die das Internet auf die intellektuelle Praxis in den neunziger Jahren ausübte, mit keinem Wort ein.
Alt-F4 oder Stop the World and let me out
Daher ist der Vorwurf des niederländischen "Netzkritikers" Geert Lovink nur zu berechtigt, der alternden Generation der "68er" (den "Kindern von Marx und Coca-Cola", wie sie bei Godard hieß) fehle die Fähigkeit, das Internet zu begreifen und es als Objekt der Theorie ernst zu nehmen. "Netzkritik ist ein Aufruf zum kritischen intellektuellen Engagement", postuliert Lovink in seinem Buch "My First Recession: Critical Internet Culture in Transition", das zum Großteil auf seiner Dissertation für die University of Melbourne beruht, aber gänzlich den üblichen akademischen Konventionen zuwider läuft. Es ist eine erfrischende Bestandsaufnahme der Internet-Kultur nach dem Ende der "Dotcom"-Hysterie der späten neunziger Jahre, als allenthalben eine "digitale Revolution" verkündet wurde, kleine Startup-Unternehmen an die Börsen drängten, zynische Geschäftemacher ihren Reibach machten und IT-Journalisten und PR-Berater das Internet als Spektakel im e-Business verhökerten. Als die Blase platzte, war auch der schnell entstandene Mythos des Webs demystifiziert.
Jenseits der "cyber-libertären" Phrasen vieler "Netizens" unterzieht Lovink die Geschichte des World Wide Webs und der damit verbundenen Veränderung der Öffentlichkeit und des Publizierens einer grundlegenden Kritik, wobei er seine Position aus dem Blickwinkel eines Medientheoretikers und "taktischen Medienproduzenten" beschreibt, die ihn zum einen befähigt, die Entwicklung neuer "Produktionsformen" (wie den Bewegungen für die "Open Source" und "Free Software") mit gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen zu verknüpfen, ihn zum anderen aber auch daran hindert, tiefer in die "digitalen" und "virtuellen" Welten einzudringen. Sein Projekt der "kritischen Internet-Kultur" möchte er nicht in direkter Verbindung mit der "Kritischen Theorie" in der Tradition von Adorno, Horkheimer und Marcuse sehen, die er durch ihre akademisierte Form kompromittiert sind. Zudem betrachtet er seine "Netzkritik" als den Versuch, die verlorene Einheit von Reflexion und Aktion wiederherzustellen. In seiner Essaysammlung "Dark Fiber" skizziert Lovink den kritischen Netzintellektuellen als "VI", als "virtuellen Intellektuellen", der aus der "Sphäre des Negativen" heraus an der Überwindung der Repräsentation und der Demokratisierung der Medien (und somit der "virtuellen Kanäle") arbeitet und den Raum für eine partizipatorische Internet-Kultur bereitet. In diesem utopischen Projekt unterscheidet sich Lovink wenig von "traditionellen" Intellektuellen wie Sartre, Debord oder den Aktivisten der Neuen Linken, die freilich nicht verhindern konnten, dass die Avantgarde, die auf ihre Abschaffung hin arbeitete, zu Rackets in der Gesellschaft mutierten. Auch in der kurzen Geschichte des Internets setzten sich bereits die Rackets durch, während offene Formen der Öffentlichkeit ins Hintertreffen gerieten. Wie bereits in früheren Zeiten lagen die Gründe hierfür nicht allein in der machtpolitischen Durchtriebenheit einer auf Herrschaft versessenen minoritären Elite, sondern auch in der Strukturlosigkeit der "Gegenöffentlichkeit", die den manipulativen Angriffen Tür und Tor öffneten.
Nachdem die rauschende Party der "Roaring Nineties" vorüber ist und sich weder die Yuppie-Träume vom schnellen Reichtum noch die utopischen Visionen der techno-libertären "Habermasianer" erfüllten, bleibt das Internet Zielgebiet sowohl großer Korporationen des globalen Kapitalismus als auch kleiner Dissidentenzirkel, die in ihren arkadischen Refugien im virtuellen Raum an der Demokratisierung des Internets arbeiten. Im Gegensatz zu früheren geschlossenen digitalen Welten, die von einigen wenigen Programmierern entwickelt wurden, ist mit der systemübergreifenden Programmiersprache Java die Gestaltung des Webs bis zu einem gewissen Grad demokratisiert worden. (Ein dunkler Nebenaspekt dieser Demokratisierung und der Popularisierung des Internets ist die Überschwemmung der digitalen Welt mit Würmern und Viren, die selbst von minderjährigen Schülern in Umlauf gebracht werden können.)
Etwas überschwänglich teilen Herbert Schildt und James Holmes in ihrem Buch "The Art of Java" die Geschichte in die Zeit vor Java und jene nach Java ein: In der Welt vor Java agierten Programmierer monadologisch, als isolierte Einzelwesen, die Programme für isolierte Einzelmaschinen schrieben, während in der Welt nach Java alles mit allem in einer vernetzten Umwelt zusammenhängt. In dieser Totalität liegen zugleich die Mächtigkeit und die Anfälligkeit dieses Systems begründet. Freilich sind Schildt und Holmes weit davon entfernt, negative Dialektik zu betreiben. Als schreibende "Techniker des Wissens" (wie sie Sartre im Gegensatz zu den Intellektuellen genannt hätte) stellen sie die "Kunst von Java" vor, etwa das "Memory Management Through Garbage Collection". Im technischen Sinne bedeutet dies, dass nicht länger benötigte Objekte, die Platz im Speicher belegen, vom Java-Müllmann automatisch entsorgt werden. Freilich lässt diese Formulierung auch die Assoziation zu, dass in der virtuellen Welt kein Platz für Erinnerung und Geschichte ist. In seinen "Kommentaren zur Gesellschaft des Spektakels" hatte bereits Debord 1988 gemutmaßt, dass mit dem Einzug des Computers Fälschung und Desinformation im Weltmaßstab betrieben würden, als inszenierten nicht näher bezeichnete Verschwörer permanent Reprisen der Moskauer Prozesse auf globaler Bühne.
Solche Unterstellungen würden Schildt und Holmes weit von sich weisen, geht es ihnen doch um die (unkritische) Demonstration der Fähigkeiten der universalen Hochsprache Java. So stellen sie beispielsweise in einem Kapitel vor, wie ein eigenes E-Mail-System zu realisieren wäre. In diesem Sinne ist Java lediglich ein technisches Instrument, das sowohl der Herrschaft als auch der Anarchie dienen kann. Stiege Tristero aus Thomas Pynchons kurzem Roman "The Crying of Lot 49" (1966) nun in die virtuelle Welt hinauf, könnte er sein subversives Kommunikationssystem in Form eines E-Mail-Clients auf POP3- und SMTP-Basis implementieren, und auch sein Faible für Akronyme (W.A.S.T.E.) würde in der Java-Welt gut bedient: J2EE, J2SDKEE, JCP, JVM, JAF, JSP, JIT und viele andere für Außenstehende nicht zu entschlüsselnde Abkürzungen unterbinden lästige Nachfragen, da ohnehin kaum jemand versteht, wovon die Rede ist.
Für die Eingeweihten ist Jacuzzi auch nicht mehr ein Whirlpool, sondern ein Java-basierter Abfrage-Optimierer, den David Yu Chen an der University of Berkeley auf Basis von anderen Java-Applikationen wie Jaguar, Tigris und Telegraph ("einem universalen Informationssystem") entwickelte, um Daten aus verschiedenen Resourcen aufzubereiten - facts & figures, wie die 'Techies' zu sagen pflegen. Alles ist Information - oder vielleicht doch Desinformation und Fälschung? Womöglich Entropie? Ist Jacuzzi lediglich ein weiteres Addendum zu "The Courier's Tragedy", das seinen Ausgang auf einem kalifornischen Schreibtisch oder einem amerikanischen Schreibtisch nahm und den Weg ins Internet fand? Wem kann noch getraut werden? "Who are you to be critical?" (Burroughs) Aber zumindest eines ist gewiss: Java ist (auch nur) eine Insel, und nur die wenigsten Flaschenposten, die vom Überleben der Intellektuellen in einer finsteren, neonlichtdurchfluteten Welt künden, erreichen ihre tatsächlichen Adressaten, versickern nicht im Schlick der Zeit.
Call me Schmidt oder Postmortale Phantomsyndrome
Gemeinhin wird das Ende des Intellektuellen auf das Jahr 1980 datiert, als Jean-Paul Sartre zu Grabe getragen wurde. Zwar hatte Sartre selbst wenige Jahre vor seinem Tod konstatiert, dass der Intellektuelle "als ein Mensch, der für andere denkt", dazu bestimmt sei, zu verschwinden, doch ist er damit heute keineswegs obsolet. Vermutlich ist dieses Urteil eher dem damaligen Zeitgeist des verschwindenden Gauchismus mit seiner Idolatrie der "Massen" geschuldet als den tatsächlichen sozialen, politischen und kulturellen Verhältnissen. Hier irrte der Philosoph ebenso wie in seinem (von Colin MacCabe überlieferten) Urteil über Orson Welles' Film "Citizen Kane", dem er 1945 in der Zeitschrift "L'Ecran français" vorwarf, es sei das Werk eines Intellektuellen, der das naive Genie des amerikanischen Kinos ignoriere und von den "Massen" abgeschnitten sei. Tatsächlich aber überdauert Sartres "Plädoyer für die Intellektuellen" aus dem Jahre 1965 die Zeiten: Darin porträtierte er den Intellektuellen als "Fehlprodukt" der bestehenden Gesellschaft, das seine Widersprüchlichkeit zugleich als Verhängnis und Verpflichtung auf sich nahm.
Der Intellektuelle war ein "PI", ein "private investigator", der zunächst über sich selbst ermittelt, "um das widersprüchliche Sein, das ihm zuteil geworden ist, in eine harmonische Totalität zu verwandeln", schrieb Sartre zur Funktion des Intellektuellen. Das Entscheidende an seiner Konzeption war die Absage an jegliche Zugehörigkeit zu einer Elite und ein Engagement für eine radikale Demokratisierung der Gesellschaft (wobei "radikal" im Marx'schen Sinne die Dinge an der Wurzel greifend bedeutete). Nicht zufällig nahm Sartre das Etikett "Anarchist" für sich in Anspruch: Obwohl er mit der politischen anarchistischen Bewegung nichts gemein hatte, begehrte er gegen die Macht und die Herrschaft auf. Daher würde er auch gegen Winocks Pathos sich enragieren, das dem Intellektuellen eine "staatsbürgerliche Gesinnung" als Betriebsmittel unterschieben möchte, auf dass alle zeitgemäßen Intellektuellen aronistische Klone seien. Wurde nach dem Scheitern des Gauchismus Sartres universeller Intellektueller von "spezifischen Intellektuellen" im Sinne Michel Foucaults oder "organischen Intellektuellen" in Anknüpfung an Antonio Gramsci abgelöst, so war es letztlich der Triumph jener, die Sartre als "falsche Intellektuelle" oder Paul Nizan als "Wachhunde" zu bezeichnen pflegte. Das "monströse Produkt monströser Gesellschaften" begehrte nicht länger (auch gegen sich selbst) auf, sondern arrangierte sich mit den herrschenden Verhältnissen. Obwohl Sartre der grassierenden Laxheit gegenüber Stil und literarischer Form, wie sie von den Exponenten des Gauchismus und später Autoren und Autorinnen der "Gegenöffentlichkeit" betrieben wurde, kritisch gegenüberstand, war er doch stets offen gegenüber neuen Formen der Öffentlichkeit. Mit Recht moniert Geert Lovink die Abwesenheit etablierter Intellektueller in den Diskussionen um die gesellschaftspolitische und kulturelle Thematik des Internets und wirft ihnen den Rückzug in konventionelle Räume technokratischer Herrschaft vor. Selbst für den prominenten Mediensoziologen Todd Gitlin ist das World Wide Web in erster Linie das Medium junger Leute, deren Optimismus bezüglich der Demokratisierung der Öffentlichkeiten und utopischen Visionen er als desillusionierter Altlinker nicht teilen möchte.
Nachdem die Linke in den verwilderten Räumen der nachbürgerlichen Gesellschaft verendete und Intellektuelle lediglich noch wie Phantome aus einem Buñuel-Film fortexistieren, hat auch das Koordinatensystem der einschlägigen Medienkartelle und ihrer Paladine all seine Relationen verloren. In dieser Wahnwelt firmiert schließlich auch ein gescheiterter, minderbegabter Kabarettist namens Harald Schmidt als Intellektueller, der im Spaß- und Sudelfunk der Schenkelklopfer mit den primären Stilmitteln Häme und Ressentiment vor jenem Publikum reüssierte, das bei anderer Gelegenheit brennende Flüchtlingsheime mit Johlen und Beifallklatschen goutierte. Für das außer Rand und Band geratene Feuilleton von links bis rechts ist Schmidt Exponent jener Elite, zu der sich die kleinen Feuilletonisten selbst rechnen möchten. Während im linken Racket-Organ "konkret" der selbst erklärte Fernsehspezialist und Satire-Fachmann Kay Sokolowsky Schmidt zum Genie adelte, brach für den eingangs erwähnten Hamburger Bordellchef offenbar die neoliberale Rotlichtwelt zusammen, denn (so zitierte ihn die "Netzeitung") Deutschland verliere alle "Hoffnung, allen Spaß, alle Intelligenz - Deutschland sinkt zurück in die völlige Dumpfheit". Als kulturelle Avantgarde ist das deutsche Feuilleton seiner Zeit stets voraus gewesen und hat sich an diesem Ort bereits vor Jahren eingerichtet. "Die Aufgabe ist es", notierte Horkheimer, "das Gegenteil von dem zu tun, was diese miserable Welt vorschreibt." Il faut continuer.
Besprochene Bücher
Colin MacCabe: Godard. A Portrait of the Artist at 70. Mit einer Filmografie von Sally Shafto.
Bloomsbury Publishing, London 2003.
432 Seiten, 25,00 £.
ISBN 0-7475-6318-77
Russell Jacoby: The Last Intellectuals. American Culture in the Age of Academe.
Basic Books, New York 2000.
290 Seiten, 20,00 US $.
ISBN 0-465-03625-2
Michael Denning: Culture in the Age of Three Worlds.
Verso, London 2004.
280 Seiten, 13,00 £.
ISBN 1-85984-449-9
Geert Lovink: Dark Fiber. Tracking Critical Internet Culture.
MIT Press, Cambridge, MA 2003.
382 Seiten, 17,95 US $.
ISBN 0-262-62180-0
Geert Lovink: My First Recession. Critical Internet Culture in Transition.
NAi Publishers, Rotterdam 2003.
260 Seiten, 29,95 US $.
ISBN 9-0-5662-35-3
Herbert Schildt, James Holmes: The Art of Java.
McGraw-Hill/Osborne, Emeryville 2003.
370 Seiten, 39,99 US $.
ISBN 0-07-222971-3
Todd Gitlin: Media Unlimited. How the Torrent of Images and Sounds Overwhelms Our Lives.
Metropolitan Books, New York 2003.
260 Seiten, 13,00 US $.
ISBN 0-8050-7283-7